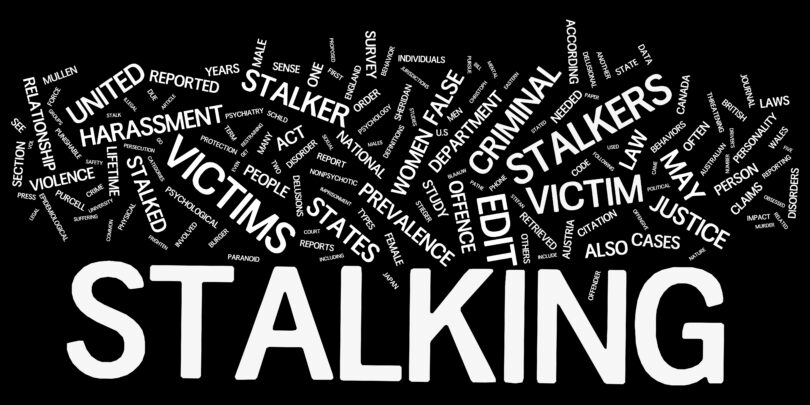Das Oberlandesgericht Hamm hatte in einem Stalking-Fall zu entscheiden, wie die wiederholten Nachstellungshandlungen gegen dasselbe Opfer zu bewerten sind – ob als fortgesetzte Straftat oder als mehrere einzelne Taten.
Nach amtsgerichtlicher Verurteilung wurde der Angeklagte im Berufungsverfahren wegen Nachstellung in Tateinheit mit Bedrohung in 14 Fällen sowie wegen Nachstellung verurteilt.
Sachverhalt
Nach den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils konnte der Angeklagte die Trennung von seiner Ehefrau nicht akzeptieren. Aus diesem Grund versandte er an diese an mehreren Tagen 14 Sprachnachrichten, die Todesdrohungen bzw. Androhungen von (sexueller) Gewalt enthielten. Ferner lauerte er ihr vor einem Supermarkt auf und konnte erst durch Verständigung der Polizei davon abgehalten werden, auf sie einzureden. Die Revision des Angeklagten war erfolgreich und führte zur Urteilsaufhebung sowie Zurückverweisung der Sache.
Normen und Leitsatz
StGB – § 238
§ 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB erfordert das tatsächliche objektive Herstellen einer räumlichen Nähe zum Opfer.
Oberlandesgericht Hamm, Beschl. v. 08.04.2025 – 5 ORs 9/25
Aus den Gründen
Im Ansatz zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass das vierzehnmalige Versenden von Sprachnachrichten und auch das Auflauern am 14.11.2022 als Nachstellungshandlungen im Sinne von § 238 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB zu werten sind, die zur erheblichen Beeinträchtigung der Lebensführung geeignet sind.
Während dies bei den Sprachnachrichten, die sämtlich Todesdrohungen und (sexuelle) Gewaltfantasien enthalten, keiner näheren Ausführungen bedarf, folgt dies beim Auflauern der Geschädigten auch ohne konkrete Drohungshandlung daraus, dass diese – wie für den Angeklagten ohne Weiteres ersichtlich – beim Zusammentreffen mit ihm mit der Umsetzung der angekündigten Gewalttaten rechnen musste.
Aufsuchen der Wohnung
Unzureichend in Bezug auf das objektive Tatgeschehen sind lediglich die Feststellungen zum Aufsuchen der Wohnung der Geschädigten am 04.12.2022. Insoweit tragen die Feststellungen nicht, da § 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB voraussetzt, dass tatsächlich objektiv eine räumliche Nähe zum Opfer hergestellt wird (…). Vorliegend lässt sich den getroffenen Feststellungen indes nicht entnehmen, ob die Nebenklägerin sich zuhause aufhielt.
Ferner erweisen sich die konkurrenzrechtliche Bewertung und damit einhergehend die Feststellungen zum subjektiven Vorstellungsbild des Angeklagten – wie die Generalstaatsanwaltschaft zutreffend ausgeführt hat – als nicht rechtsfehlerfrei.
Tatbestandsmerkmal „wiederholt“
Durch das zum 01.10.2021 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings sowie Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution“ wurde das bis dahin strafbarkeitsbegründende Tatbestandsmerkmal „beharrlich“ durch das Tatbestandsmerkmal „wiederholt“ ersetzt.
Wie viele belästigende Verhaltensweisen hierfür erforderlich sind, ist eine Frage des Einzelfalls. Notwendig ist aber in jedem Fall ein zumindest zweifaches Nachstellen (…). Bereits aus diesem Grund können einzelne Nachstellungshandlungen keine selbstständigen Taten sein. Vielmehr sind mehrere Nachstellungshandlungen zu einer materiell-rechtlichen selbstständigen Nachstellungstat zusammenzufassen.
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mehrere Tathandlungen gegen dasselbe Tatopfer eine einheitliche Tat in der Form einer tatbestandlichen Handlungseinheit bilden können (…).
Maßgebliches Kriterium für Bewertung
Maßgebliches Kriterium für die Zusammenfassung der in § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StGB genannten Tathandlungen ist das subjektive Vorstellungsbild des Täters (…). Handlungen, die einen ausreichenden räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufweisen und von einem fortbestehenden einheitlichen Willen des Täters getragen werden, stellen eine einheitliche Tat dar. Anders als bei der natürlichen Handlungseinheit ist hierbei kein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang des strafbaren Verhaltens zu fordern. Vielmehr können zwischen den einzelnen tatbestandsausfüllenden Teilakten erhebliche Zeiträume liegen (…).
Eine neue Tat beginnt dementsprechend erst dann, wenn hinreichend geeignete Handlungen zunächst einen Abschluss gefunden haben und sodann aufgrund eines neuen Tatentschlusses wiederum angesetzt wird (…). Lassen sich hierzu keine Feststellungen treffen, wird im Zweifel nur eine einzige Tat angenommen werden können (…).
Fortbestehender einheitlicher Wille des Täters
Ausgehend von dem aufgezeigten Maßstab fehlt es vorliegend an Feststellungen dazu, welche Nachstellungshandlungen von einem fortbestehenden einheitlichen Willen des Angeklagten getragen werden und wann dieser eine neue Phase der Entschlussbildung durchlaufen hat. Umstände, die eine Zäsur begründen könnten, lassen sich den Feststellungen nicht entnehmen. Insbesondere hinsichtlich der an einem Tag – teilweise im Abstand weniger Minuten – versandten Sprachnachrichten dürfte eine einheitliche Motivationslage naheliegen und die Fassung eines eigenen Tatentschlusses abzulehnen sein.
Neubewertung des Falls
Für die erneute Hauptverhandlung weist der Senat auf Folgendes hin: Nach dem Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB dürfen Umstände, die zum regelmäßigen Erscheinungsbild eines Straftatbestandes zählen, im Allgemeinen nicht strafschärfend gewertet werden (…).
Hinsichtlich der Anzahl der versandten Sprachnachrichten und deren Eignung, die Geschädigte in Angst und Schrecken zu versetzen, wird im Rahmen der erneuten Strafzumessung daher zu sehen sein, dass die wiederholte Begehung von Nachstellungshandlungen Grundbedingung für die Verwirklichung von § 238 StGB und die Eignung zur Einschüchterung des Adressaten Grundbedingung für die Verwirklichung des § 241 StGB ist. Zulässig ist hingegen die tateinheitliche Begehung von Nachstellung und Bedrohung strafschärfend zu würdigen.
Die im Rahmen der Bewährungsfrage zu stellende Legalprognose setzt nach § 56 Abs. 1 Satz 2 StGB eine Gesamtwürdigung (…) voraus. (…). Im Hinblick darauf, dass die verfahrensgegenständlichen Nachstellungshandlungen nunmehr mehr als zwei Jahre zurückliegen, wird insbesondere – wie mit der Verfahrensrüge beanstandet – aufzuklären sein, ob und mit welchem Erfolg der Angeklagte sich einer therapeutischen Behandlung unterzogen hat und ob der Angeklagte auch weiterhin nicht die Trennung von seiner Ehefrau akzeptiert.
Entnommen aus dem Neuen Polizeiarchiv (NPA) 09/2025, Lz. 336.