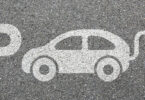In Bezug auf eine umstrittene polizeiliche Untersagung zum Führen von Messern hat das OVG NRW ausgeführt, dass die speziellen Eingriffsgrundlagen des WaffG nach dem Willen des Bundesgesetzgebers nicht dazu führen sollen, dass landesrechtliches Einschreiten im konkreten Einzelfall zum Zwecke der Gefahrenabwehr ausgeschlossen ist.
Dem Antragsteller wurde von dem zuständigen Polizeipräsidium verboten, für die Dauer von drei Jahren alle Arten von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit zu führen. Gegen diese sofort vollziehbare Verfügung wandte sich der Antragsteller an das Verwaltungsgericht (VG) und beantragte, die aufschiebende Wirkung gegen die Verfügung anzuordnen. Der Antrag hatte zunächst Erfolg, jedoch blieb seine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG) erfolglos.
Interessenabwägung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung war formell rechtmäßig; sie genügte auch insbesondere dem Begründungserfordernis des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Die Interessenabwägung ergab, dass das öffentliche Vollzugsinteresse die privaten Interessen des Antragstellers überwog. Die Verfügung erwies sich nicht als offensichtlich rechtswidrig.
Keine Verdrängung polizeilicher Vorschriften durch WaffG
Die Verfügung beruht auf der polizeilichen Generalklausel des § 8 Abs. 1 PolG NRW (in Baden-Württemberg §§ 3, 1 PolG). Danach kann die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um im Einzelfall eine konkrete Gefahr von der öffentlichen Sicherheit abzuwenden.
Das VG war der Auffassung, dass die polizeiliche Generalklausel vorliegend nicht anwendbar sei, da sie durch die spezielleren Vorschriften des Waffengesetzes – für das der Bund die Gesetzgebungszuständigkeit habe – verdrängt werde. Der Bundesgesetzgeber habe durch erst kürzlich vorgenommene Änderungen des Waffengesetzes (WaffG) zum Ausdruck gebracht, dass dieses sich auch auf sämtliche Alltagsmesser erstrecken und somit im Hinblick auf Messer eine umfassende Regelung treffen soll.
Das OVG teilt die Ausführungen des VG zwar grundsätzlich. Die bundesrechtlichen Regelungen und die speziellen Eingriffsgrundlagen des WaffG sollen nach den Ausführungen des OVG jedoch auch nach dem Willen des Bundesgesetzgebers nicht dazu führen, dass landesrechtliches Einschreiten im konkreten Einzelfall zum Zwecke der Gefahrenabwehr ausgeschlossen ist.
Individuelles Verhalten des Adressaten als Anknüpfungspunkt
Zu berücksichtigen ist insoweit, dass die auf der polizeilichen Generalklausel beruhende Polizeiverfügung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Einzelfall abwehren soll, und nicht eine lediglich abstrakte Gefahr, die mit dem betreffenden Gegenstand bzw. der Waffe typischerweise einhergeht. Anknüpfungspunkt ist somit schwerpunktmäßig das individuelle Verhalten des Adressaten im Einzelfall und nicht die Gefährlichkeit des Gegenstandes als solchem.
Zweck der polizeilichen Maßnahme im Einzelfall ist somit u. a., dem Störer, der aufgrund der polizeilichen Gefahrenprognose mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Straftaten begehen wird, die Einsatzmöglichkeit gefährlicher Tatwerkzeuge zu nehmen bzw. wenigstens zu erschweren.
Dass der Bundesgesetzgeber mit den Vorschriften des Waffengesetzes nicht polizeiliche Befugnisse nach Landesrecht einschränken wollte, ergibt sich aus dem Rechtsgedanken des § 42b Abs. 2 Satz 4 WaffG. Danach bleiben die sonstigen Befugnisse der Bundespolizeibehörden, das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen durch Allgemeinverfügung zu regeln, unberührt. Entsprechende Erläuterungen finden sich auch in der Gesetzesbegründung. Diesen Rechtsgedanken überträgt das OVG auch auf die Landespolizei.
Stützung der Verfügung auf polizeiliche Generalklausel
Nach Ansicht des VG war aus verfassungsrechtlicher Sicht noch zweifelhaft, ob die Verfügung im Hinblick auf die Wesentlichkeitstheorie auf die polizeiliche Generalklausel gestützt werden konnte. Dies war aber schon deswegen zu verneinen, da das zeitlich (hier: drei Jahre) befristete und auch örtlich umgrenzte Verbot, Messer und andere gefährliche Gegenstände zu führen, nur einen geringen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG darstellt.
Es liegt somit kein erheblicher Grundrechtseingriff vor, der nach der Wesentlichkeitstheorie nur auf eine spezielle Eingriffsermächtigung gestützt werden könnte. Dies folgt auch daraus, dass die Verfügung zahlreiche Ausnahmen für das Mitführen enthält, und somit von dem Verbot des Mitführens von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen letztlich im Wesentlichen nur solche Gegenstände umfasst sind, die von alltäglicher Gebrauchsmöglichkeit weit entfernt sind. Zudem wird vom Antragsteller auch kein positives Tun, sondern lediglich ein Unterlassen verlangt.
Verfügung voraussichtlich verhältnismäßig
Die Verfügung ist voraussichtlich auch verhältnismäßig, da sie dem Zweck der Gefahrenabwehr dient und hierzu geeignet ist. Dass die Einhaltung der Verfügung unter Umständen nur schwer kontrolliert werden kann, steht der Geeignetheit nicht entgegen, da für die Geeignetheit nur erforderlich ist, dass die Verfügung hilft, den Zweck zu erreichen, eine sichere Zweckerreichung ist nicht erforderlich.
Die Verfügung ist auch erforderlich und angemessen, insbesondere im Hinblick auf die verhältnismäßig geringe Zeitdauer des Verbots von drei Jahren. Hierdurch wird der Antragsteller nicht in unzumutbarer Weise belastet.
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 08.07.2025 – 5 B 579/25
Entnommen aus der Fundstelle Baden-Württemberg 19/2025, Lz. 275.