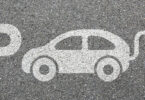Der Beitrag befasst sich mit den im neuen Versammlungsgesetz NRW enthaltenen Vorschriften, die den Schutz von Versammlungen gewährleisten sollen. Mit dem (im Unterschied zum bisherigen VersG des Bundes) ausdrücklich ins Gesetz aufgenommenen Schutzauftrag (§ 3 Abs. 1 VersG NRW) und dem textlich abweichend vom VersG ausgestalteten Störungsverbot (§ 7 VersG NRW) hat der Gesetzgeber in NRW ein Schutz-System geschaffen, dessen verfassungsrechtlicher Hintergrund und praktische Anwendbarkeit im Folgenden erläutert werden.
(…)
Der verfassungsrechtliche Hintergrund
Ob der Staat Versammlungen schützt, steht nicht im Belieben des (einfachen) Gesetzgebers. Es handelt sich beim Versammlungsschutz vielmehr um eine aus dem Grundgesetz resultierende Verpflichtung. Die Verfassung zwingt den Staat, für Sicherheit zu sorgen und insbesondere die grundrechtlich geschützten Rechtspositionen der Bürger zu schützen. Dieser objektiven Schutzpflicht muss der Staat nachkommen, weil er nur dann das von ihm in Anspruch genommene staatliche Gewaltmonopol zu rechtfertigen vermag.
Die Schutzpflicht des Staates ist aber nicht nur eine objektive. Vielmehr kann der Bürger vom Staat auch verlangen, dass er das grundrechtlich gewährleistete Tun des Bürgers schützt. Die subjektive Schutzpflicht folgt aus den Grundrechten und wird dementsprechend als grundrechtliche Schutzpflicht bezeichnet. Auch wenn nur wenige Grundrechte (v.a. Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG sowie Art. 6 Abs. 1 und Abs. 4 GG) in ihrem Text ausdrücklich die Schutzpflicht erwähnen, besteht doch heute weitgehend Einigkeit über die grundrechtliche Schutzpflicht als für alle (Freiheits-)Grundrechte geltenden Grundsatz. Dementsprechend ist der Staat verpflichtet, Bürger zu schützen, die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG wahrnehmen – und die betroffenen Bürger können vom Staat auch verlangen, dieser Pflicht nachzukommen. Auf der anderen Seite gibt es kein „(Grund-)Recht auf Störung“ einer Versammlung.
Dogmatisch mag man zwar streiten, ob es (im Sinne eines „neminemlaedere- Gebots“) schon von vornherein ausgeschlossen ist, dass der Schutzbereich eines Grundrechts die gezielte Verletzung der grundrechtlich geschützten Rechtspositionen anderer Menschen gewährleistet. Zumindest findet aber die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ihre Schranken u. a. an den Rechten Anderer. Im Ergebnis ist ein gezielter Angriff auf Grundrechtswahrnehmung anderer Personen verfassungsrechtlich nicht zulässig.[1] Auf einem anderen Blatt stehen Grundrechtskonflikte, die sich ungewollt ergeben können, wenn zwei Personen jeweils ihr Grundrecht wahrnehmen – darum geht es aber beim Störungsverbot nicht, das ja nur die auf Behinderung gerichtete Störung einer Versammlung verbietet. Foto: Decker, Hagen
Schutzumfang: Störungen und Gefahren
Bei Gegenüberstellung der Normtexte zur Schutzaufgabe (§ 3 Abs. 1 VersG NRW) und zum Störungsverbot (§ 7 VersG NRW) ist zunächst einmal ein umfassenderer Umfang der Schutzaufgabe im Vergleich zum Störungsverbot festzustellen: Die Schutzaufgabe verpflichtet die Polizei, Versammlungen vor jeglicher Störung und außerdem vor Gefahren zu schützen; das Störungsverbot verbietet lediglich auf Behinderung zielende Störungen und befasst sich gar nicht mit Gefahren.[2]
Man muss also zwischen Störungen und Gefahren unterscheiden und zudem bei den Störungen zwischen auf Behinderung zielenden Störungen und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, differenzieren. Der Begriff „Gefahr“ ist im Versammlungsrecht nicht anders zu verstehen als im allgemeinen Polizeirecht. Eine Gefahr liegt mithin vor bei einer Sachlage, in der es in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit zu kommen droht.
Eine Versammlung ist insoweit v.a. mit Blick auf die körperliche Unversehrtheit, das Eigentum und die Bewegungsfreiheit der Versammlungsteilnehmer zu schützen. Der Terminus „Störung“ meint demgegenüber einen Zustand, in dem die Versammlung nicht mehr so ablaufen kann, wie das seitens der Versammlungsbeteiligten eigentlich gewollt ist. Es geht hier um den Schutz der Ordnung der Versammlung. Die Ordnung der Versammlung wird grundsätzlich nicht durch die staatliche Rechtsordnung, sondern durch den Willen der Versammlungsbeteiligten bestimmt.
In den meisten Fällen wird eine Gefahr für die Versammlung zugleich eine Störung bedeuten und umgekehrt. Es sind aber Konstellationen denkbar, in denen nur einer der beiden Begriffe zu bejahen ist. So konnte man bspw. bei manchen „Corona-Demonstrationen“ ohne Abstand und Maske argumentieren, hier bestehe eine Gefahr für die Gesundheit der Beteiligten.
Wenn das Demonstrieren ohne Abstand und Maske aber im Sinne der Veranstalter und Teilnehmer war, gab es keine Störung der Ordnung der Versammlung. Umgekehrt liegt z. B. eine Störung der Ordnung der Versammlung vor, wenn ein Teilnehmer bei einem Schweigemarsch Parolen ruft, doch ist hier eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit wohl nicht gegeben. Die Schutzaufgabe der Polizei besteht in all diesen Konstellationen.[3] Sowohl Gefahren als auch Störungen können ihre Ursache in einem gezielt gegen die Versammlung gerichteten Tun von Personen haben, aber auch unabhängig hiervon entstehen. Fälle nicht-gezielt verursachter Gefahren bzw. Störungen gibt es etwa im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, Baustellen (Lärm!) und sogar ohne menschliches Zutun (Hagelschauer).
Hier besteht zwar eine Schutzaufgabe der Polizei, doch muss diese natürlich die Grundrechte der (unabsichtlich) Störenden bzw. Gefahrverursacher berücksichtigen und mit der Versammlungsfreiheit und den sonstigen betroffenen Grundrechten der Versammlungsteilnehmer in Abwägung bringen. Zudem bedeutet Schutzaufgabe nicht „umfassende Fürsorgepflicht“; so wird die Polizei z. B. nicht zugunsten der Versammelten eine Plane zum Schutz vor Hagel aufspannen müssen. Das Störungsverbot spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle; ein Handeln, das anderen Zwecken dient als der Behinderung der Versammlung, ist nicht verboten (Beispiel: üblicherweise beim Betrieb einer zufällig in der Nähe des Versammlungsortes befindlichen Baustelle entstehender Baulärm).
(…)
Fazit
Mit der ausdrücklichen Aufnahme der Schutzaufgabe in das Gesetz (§ 3 Abs. 1 VersG NRW) und der Neuformulierung des Störungsverbots (§ 7 VersG NRW) sowie den ergänzenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenbestimmungen ist es dem NRW-Gesetzgeber gelungen, die verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Versammlungsschutz im Gesetz abzubilden.[4] Damit erweist sich das VersG NRW als versammlungsfreundlich und erleichtert es der Polizei, ihrer grundrechtlichen Schutzpflicht gerecht zu werden – auch in Fällen, in denen es um den Schutz politisch unpopulärer Versammlungen geht. Situationen unzureichenden Eingreifens von Behörden zum Schutz von Versammlungen sollten damit in NRW der Vergangenheit angehören.[5]
Gegendemonstrationen bleiben Bestandteil eines lebendigen politischen Meinungskampfes. Für alle Beteiligten gilt weiterhin, was in der freiheitlichen Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte: Die Freiheit der Andersdenkenden ist zu achten; ihrer Meinung darf mit Argumenten entgegengetreten werden, nicht mittels Behinderung.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie im Deutschen Polizeiblatt, 6/2022, S. 13.
[1] Müller-Franken, in: Schmidt-Bleibtreu, GG, 15. Aufl. 2021, Rn. 21 zu Art. 8.
[2] Vgl. von Coelln/Klein/Pernice-Warnke/Pützer, NWVBl. 2022, 313, 314.
[3] Vgl. Ullrich/Roitzheim, a. a. O., Rn. 11 zu § 3.
[4] Vgl. Schönenbroicher, VersG NRW, 2022, Rn. 2 zu § 7. 18 Ullrich, DVBl 2022, 220, 221.
[5] Ullrich, DVBl 2022, 220, 221.